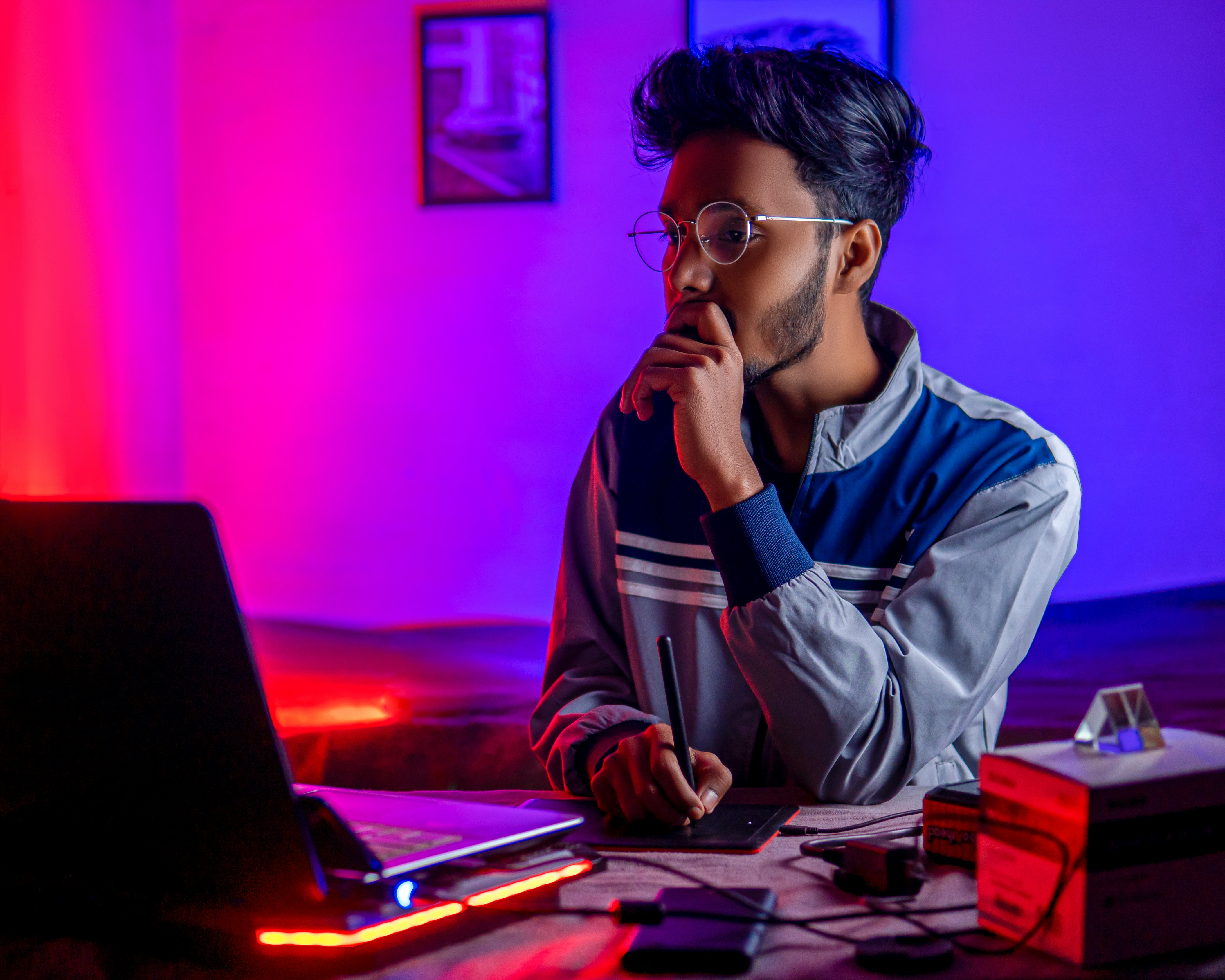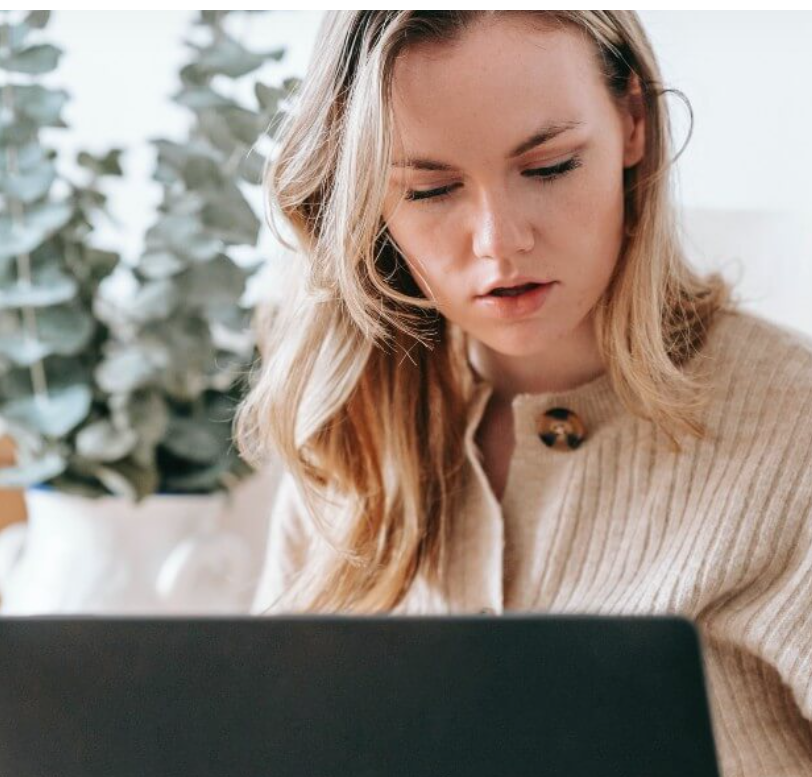Die Haftung ist eines der wichtigsten Themen für Einzelunternehmer*innen. Im Unterschied zu anderen Unternehmensformen haften sie mit ihrem gesamten persönlichen Vermögen für geschäftliche Schulden.
Dieser Blogbeitrag bietet Ihnen einen umfassenden Überblick von grundlegenden Haftungsregelungen über spezifische Risiken bis hin zu präventiven Maßnahmen und Versicherungen, die helfen, Ihr Privatvermögen zu schützen. Zusätzlich erhalten Sie praktische Tipps, um Haftungsrisiken aktiv zu minimieren.
Was bedeutet Haftbarkeit? Definition & Beispiele
Bei der Haftbarkeit geht es darum, ob und in welchem Umfang eine Person oder ein Unternehmen haftet – also für etwas einstehen muss, insbesondere finanziell. Sehen wir uns das in den nächsten Punkten genauer an.
➡️ Definition im rechtlichen Kontext
Haftbarkeit bedeutet: Die rechtliche Fähigkeit oder Verpflichtung, für eigenes oder fremdes Verhalten, für Schäden oder für Vertragsverletzungen zur Rechenschaft gezogen zu werden – meist in Form von Schadensersatz oder der Erfüllung von Verbindlichkeiten.
➡️ Beispiele für Haftbarkeit
Vertragliche Haftbarkeit: Wenn Sie einen Vertrag abschließen und Ihre Pflichten daraus nicht erfüllen, können Sie haftbar gemacht werden.
Deliktische Haftbarkeit: Wenn Sie jemandem durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz einen Schaden zufügen (z. B. durch einen Unfall), haften Sie nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 823 ff. BGB).
Haftbarkeit als Unternehmer*in: Als Einzelunternehmer*in haften Sie für alle betrieblichen Schulden und Schäden – auch mit Ihrem Privatvermögen.
Haftbarkeit bei Angestellten: Auch Mitarbeiter*innen können haftbar gemacht werden, z. B. bei grober Fahrlässigkeit im Job.
➡️ Bedeutung für Unternehmer*innen
Für Sie als Einzelunternehmer*in bedeutet Haftbarkeit, dass Sie grundsätzlich für alle geschäftlichen Handlungen und deren Folgen persönlich verantwortlich sind. Diese Haftbarkeit kann durch bestimmte Maßnahmen (mehr dazu weiter unten) reduziert oder abgesichert werden – aber sie besteht zunächst uneingeschränkt.
Wie haftet ein*e Einzelunternehmer*in?
Als Einzelunternehmer*in haften Sie in Deutschland grundsätzlich unbeschränkt mit Ihrem gesamten Vermögen – sowohl mit dem betrieblichen als auch mit Ihrem privaten Vermögen.
Das bedeutet: Wenn Ihr Unternehmen Schulden macht oder rechtliche Ansprüche gegen Sie geltend gemacht werden, können Gläubiger*innen auch auf Ihr Privatvermögen zugreifen.
Die wichtigsten Aspekte der Haftung als Einzelunternehmer*in sind wie folgt:
1️⃣ Unbeschränkte Haftung
Als Einzelunternehmer*in gibt es keine rechtliche Trennung zwischen Ihnen und Ihrem Unternehmen. Sie sind die natürliche Person, die das Unternehmen führt – und damit auch persönlich für alle Verbindlichkeiten verantwortlich.
Das umfasst:
Kredite und Darlehen
offene Rechnungen gegenüber Lieferant*innen
Schadensersatzforderungen
Steuerschulden
2️⃣ Keine Haftungsbeschränkung durch die Rechtsform
Im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften wie der GmbH oder UG (haftungsbeschränkt), bei denen die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen begrenzt ist, tragen Sie als Einzelunternehmer*in das volle Risiko. Es gibt keine „juristische Person“, die zwischen Ihnen und dem Unternehmen steht.
3️⃣ Haftung bei Vertragsverhältnissen
Wenn Sie Verträge abschließen – etwa mit Kund*innen, Lieferant*innen oder Dienstleister*innen – tun Sie das in Ihrem eigenen Namen. Kommt es zu Streitigkeiten oder Vertragsverletzungen, haften Sie persönlich.
4️⃣ Haftung bei Fehlern oder Schäden
Auch bei beruflichen Fehlern, etwa durch Fahrlässigkeit oder Missverständnisse, können Schadensersatzansprüche entstehen. Besonders relevant ist das in beratenden Berufen (z. B. als Steuerberater*in, Coach oder IT-Dienstleister*in).
5️⃣ Haftung bei Steuern und Sozialabgaben
Sie sind verpflichtet, Ihre Steuererklärungen korrekt und fristgerecht abzugeben. Bei Fehlern oder Versäumnissen haften Sie persönlich – auch bei Betriebsprüfungen oder Nachforderungen durch das Finanzamt.
Der Sonderfall der PartG mbB
Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB) ist eine spezielle Rechtsform für Freiberufler*innen. Sie begrenzt die Haftung auf das Vermögen der Gesellschaft, ähnlich wie bei einer GmbH. Das bedeutet, dass bei Haftungsansprüchen nur das Gesellschaftsvermögen herangezogen wird, während das Privatvermögen der Partner*innen geschützt bleibt.
Diese Rechtsform eignet sich besonders für Berufsgruppen wie Rechtsanwält*innen, Steuerberater*innen oder Ärzt*innen, die ein höheres Risiko für berufliche Haftungsansprüche haben.
Wie können Einzelunternehmen ihr Privatvermögen schützen? 8 Strategien
Als Einzelunternehmer*in haften Sie mit Ihrem gesamten Vermögen – also auch mit Ihrem privaten Besitz wie Immobilien, Ersparnissen oder Wertgegenständen. Diese Haftung kann im Ernstfall existenzbedrohend sein. Es gibt jedoch mehrere Schutzmechanismen, die Sie präventiv ergreifen können, um Ihr Privatvermögen abzusichern.
1️⃣ Rechtsform wechseln: Gründung einer haftungsbeschränkten Gesellschaft
Die sicherste Möglichkeit, Ihr Privatvermögen zu schützen, ist die Umwandlung Ihres Einzelunternehmens in eine haftungsbeschränkte Gesellschaft:
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung):
Sie haften nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Das Privatvermögen bleibt geschützt, solange keine persönliche Bürgschaft übernommen wurde.
UG (haftungsbeschränkt):
Eine Variante der GmbH mit geringem Startkapital (ab 1 €). Ideal für Gründer*innen mit begrenzten Mitteln.
Vorteil: Die Haftung ist auf das Gesellschaftsvermögen begrenzt. Ihr Privatvermögen ist grundsätzlich nicht angreifbar.
2️⃣ Versicherungen als Schutzschild
Versicherungen sind ein zentraler Bestandteil der Risikovorsorge. Sie decken Schäden ab, die sonst zu privaten Haftungsrisiken führen könnten:
Betriebshaftpflichtversicherung:
Schützt vor Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die durch Ihre betriebliche Tätigkeit entstehen.
Berufshaftpflichtversicherung:
Besonders wichtig für beratende, medizinische oder kreative Berufe. Sie deckt Vermögensschäden durch Fehlberatung oder Fehler ab.
Rechtsschutzversicherung für Unternehmen:
Übernimmt Anwalts- und Gerichtskosten bei rechtlichen Auseinandersetzungen.
Inhaltsversicherung:
Schützt Ihre Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte vor Schäden durch Feuer, Einbruch, Leitungswasser etc.
Tipp: Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Versicherungssummen und -bedingungen noch zu Ihrem Geschäftsmodell passen.
3️⃣ Vertragliche Haftungsbegrenzung
Durch sorgfältig formulierte Verträge und AGB können Sie Ihre Haftung in bestimmten Bereichen einschränken:
Ausschluss oder Begrenzung von Schadensersatzansprüchen
Definition von Leistungsgrenzen und Haftungsobergrenzen
Regelungen zu Gewährleistung und Verzug
Wichtig: Solche Klauseln müssen rechtlich zulässig und transparent sein – sonst sind sie unwirksam. Lassen Sie Ihre AGB idealerweise juristisch prüfen.
4️⃣ Strategische Vermögensübertragung
Sie können Teile Ihres Vermögens rechtzeitig aus dem Haftungsbereich herausnehmen:
Übertragung auf Familienangehörige:
Immobilien oder Kapitalvermögen können auf Ehepartner*innen oder Kinder übertragen werden – z. B. durch Schenkung oder Verkauf.
Gründung einer Familiengesellschaft oder Stiftung:
Vermögenswerte werden in eine Gesellschaft eingebracht, deren Gesellschafter*innen Ihre Familie ist. So sind sie rechtlich vom Unternehmen getrennt.
Achtung: Solche Übertragungen müssen frühzeitig erfolgen. Bei drohender Insolvenz können sie angefochten werden (§§ 129 ff. InsO).
5️⃣ Trennung von Privat- und Betriebsvermögen
Führen Sie eine strikte Trennung zwischen privaten und betrieblichen Finanzen:
Separate Bankkonten
Keine private Nutzung von Betriebsmitteln
Klare Buchführung
Diese Trennung hilft nicht nur bei der Haftungsvermeidung, sondern auch bei der steuerlichen Transparenz.
Tipp: Nutzen Sie das kostenlose Geschäftskonto von Tide, um Ihre betrieblichen Finanzen effektiv zu verwalten.
6️⃣ Keine privaten Bürgschaften oder Sicherheiten
Vermeiden Sie es, private Sicherheiten für betriebliche Kredite zu stellen:
Keine Grundschuld auf das private Eigenheim
Keine Bürgschaft für Geschäftskredite
Alternative: Verhandeln Sie mit Ihrer Bank über rein betriebliche Sicherheiten oder nutzen Sie Förderprogramme mit Haftungsfreistellung.
7️⃣ Ehevertrag und Gütertrennung
Ein Ehevertrag kann verhindern, dass Ihr*e Partner*in im Fall einer Trennung oder Insolvenz mithaftet:
Gütertrennung schützt das Vermögen des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin
Modifizierte Zugewinngemeinschaft kann individuell angepasst werden
Hinweis: Lassen Sie sich hierzu von einem oder einer Notar*in oder Fachanwält*in für Familienrecht beraten.
8️⃣ Professionelle Beratung in Anspruch nehmen
Ein*e erfahrene*r Steuerberater*in oder Rechtsanwält*in kann Ihnen helfen:
Risiken frühzeitig zu erkennen
Verträge rechtssicher zu gestalten
Vermögensschutz individuell zu planen
Wie sieht es mit der Haftung von e. K. und Kleingewerbe aus?
Die Haftung bei einem Einzelunternehmen hängt wesentlich davon ab, ob Sie als eingetragener Kaufmann (e. K.) oder als Kleingewerbetreibende*r tätig sind. Beide Varianten sind Formen des Einzelunternehmens, unterscheiden sich aber in rechtlicher Hinsicht, insbesondere in Bezug auf die Buchführungspflichten und die Anwendung des Handelsgesetzbuchs (HGB).
Die Haftung ist jedoch in beiden Fällen grundsätzlich unbeschränkt – das heißt, Sie haften mit Ihrem gesamten Vermögen, einschließlich Ihres Privatvermögens.
➡️ Haftung als eingetragene*r Kaufmann bzw. Kauffrau (e. K.)
Wenn Sie sich als Einzelunternehmer*in ins Handelsregister eintragen lassen, führen Sie den Zusatz e. K. (eingetragener Kaufmann bzw. eingetragene Kauffrau). Diese Eintragung bringt einige Vorteile mit sich, etwa ein professionelleres Auftreten gegenüber Geschäftspartner*innen, Banken und Behörden sowie die Möglichkeit, einen Fantasienamen als Firmenbezeichnung zu führen. Gleichzeitig unterliegen Sie den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB), was unter anderem eine doppelte Buchführung und Bilanzierungspflicht mit sich bringt.
Was die Haftung betrifft, so gilt: Auch als e. K. haften Sie unbeschränkt mit Ihrem gesamten Vermögen. Das bedeutet, dass bei finanziellen Schwierigkeiten oder rechtlichen Ansprüchen nicht nur Ihr Geschäftsvermögen, sondern auch Ihr Privatvermögen – etwa Ihr Haus, Ihre Ersparnisse oder Ihr Auto – zur Begleichung von Schulden herangezogen werden kann. Diese Haftung ist nicht auf das Betriebsvermögen begrenzt, da Sie als natürliche Person und nicht als juristische Person auftreten.
Ein bekanntes Beispiel für die Risiken dieser Haftung ist der Fall des Drogeriemarktgründers Anton Schlecker, der als e. K. firmierte und im Zuge der Insolvenz auch mit seinem Privatvermögen haftete.
Mehr zum Thema: So wählen Sie den richtigen Firmennamen für Ihr Einzelunternehmen
➡️ Haftung bei Kleingewerbe
Wenn Sie ein Gewerbe betreiben, das nach Art und Umfang keinen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, gelten Sie als Kleingewerbetreibende*r. In diesem Fall ist keine Eintragung ins Handelsregister notwendig, und Sie unterliegen nicht dem HGB, sondern ausschließlich dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Die Buchführungspflichten sind deutlich geringer – meist genügt eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) – und Sie müssen keine Bilanz erstellen.
Auch hier gilt jedoch: Die Haftung ist unbeschränkt. Sie haften mit Ihrem gesamten Vermögen für alle Verbindlichkeiten, die aus Ihrer gewerblichen Tätigkeit entstehen. Das betrifft sowohl das Betriebsvermögen als auch Ihr Privatvermögen. Es besteht also kein Unterschied zur Haftung eines e. K., was die Reichweite der persönlichen Verantwortung betrifft.
Die Unterscheidung zwischen e. K. und Kleingewerbe betrifft also vor allem die formalen und buchhalterischen Anforderungen, nicht die Haftungsfrage. Beide Formen sind nicht haftungsbeschränkt, da sie keine juristischen Personen darstellen.
Wie sieht die Haftung eines Einzelunternehmens bei Übernahme, Auflösung und Erbfolge aus?
Die Haftung eines Einzelunternehmens bei Übernahme, Auflösung und Erbfolge ist ein komplexes Thema, das sowohl rechtliche als auch wirtschaftliche Konsequenzen für Sie als Einzelunternehmer*in oder für Ihre Nachfolger*innen haben kann. Im Folgenden erläutern wir Ihnen die jeweiligen Situationen ausführlich.
1️⃣ Haftung bei Übernahme eines Einzelunternehmens
Wenn Sie ein Einzelunternehmen übernehmen – sei es durch Kauf, Schenkung oder im Rahmen einer Nachfolgeregelung – treten Sie nicht nur in die Rechte, sondern auch in die Pflichten und Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers bzw. Inhaberin ein. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie das Unternehmen unter der bisherigen Firma weiterführen, also den Namen beibehalten.
Nach § 25 Abs. 1 HGB haften Sie als Übernehmer*in automatisch für alle bestehenden Geschäftsverbindlichkeiten, unabhängig davon, ob diese Ihnen bekannt waren oder nicht.
Dazu zählen:
offene Rechnungen
Steuerschulden
laufende Verträge
arbeitsrechtliche Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden
Diese Haftung ist unbeschränkt und betrifft auch Ihr Privatvermögen. Sie können sich nur dann von dieser Haftung befreien, wenn Sie keine Fortführung des Unternehmens vornehmen oder wenn Sie mit dem Übergeber bzw. Übergeberin vertraglich eine Haftungsfreistellung vereinbaren, die auch gegenüber Dritten wirksam ist – was in der Praxis jedoch schwierig umzusetzen ist.
Daher ist es entscheidend, dass Sie vor einer Übernahme eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchführen. Lassen Sie sich alle Verträge, Bilanzen, Steuerbescheide und laufenden Verpflichtungen offenlegen und rechtlich prüfen. Nur so können Sie abschätzen, welche Risiken Sie übernehmen und ob eine Haftungsbegrenzung möglich ist.
2️⃣ Haftung bei Auflösung eines Einzelunternehmens
Wenn Sie Ihr Einzelunternehmen auflösen möchten – sei es aus Altersgründen, wegen Geschäftsaufgabe oder Umwandlung in eine andere Rechtsform – endet Ihre unternehmerische Tätigkeit nicht automatisch mit der Abmeldung beim Gewerbeamt. Vielmehr müssen Sie aktiv dafür sorgen, dass auch Ihre Haftung beendet wird.
Solange das Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist (z. B. als e. K.), bleiben Sie rechtlich als Kaufmann bzw. Kauffrau bestehen und haften weiterhin für alle Verpflichtungen, auch wenn Sie keine Geschäfte mehr tätigen.
Die Auflösung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:
Liquidation mit Sperrjahr: Sie kündigen alle laufenden Verträge, begleichen offene Forderungen und lassen das Unternehmen nach einem Sperrjahr aus dem Handelsregister löschen.
Löschung wegen Vermögenslosigkeit (§ 394 FamFG): Wenn kein Vermögen mehr vorhanden ist, kann das Unternehmen schneller gelöscht werden.
Löschung auf Antrag (§ 31 Abs. 2 HGB): Wenn Sie nachweisen, dass keine Geschäftstätigkeit mehr besteht, kann das Unternehmen ohne Sperrjahr gelöscht werden.
Erst mit der rechtskräftigen Löschung aus dem Handelsregister endet Ihre persönliche Haftung. Bis dahin bleiben Sie für alle Altverbindlichkeiten verantwortlich. Es ist daher ratsam, die Auflösung professionell begleiten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Haftung wirksam zu beenden.
3️⃣ Haftung bei Erbfolge eines Einzelunternehmens
Stirbt der Inhaber oder die Inhaberin eines Einzelunternehmens, geht das Unternehmen nicht automatisch unter. Vielmehr wird es im Rahmen der sogenannten Gesamtrechtsnachfolge (§ 1922 BGB) Teil des Nachlasses und geht vollständig auf die Erben über.
Das bedeutet: Die Erb*innen übernehmen alle Rechte und Pflichten, also auch die Haftung für bestehende Schulden und laufende Verpflichtungen. Diese Haftung ist ebenfalls unbeschränkt und betrifft das private Vermögen der Erb*innen.
Besonders problematisch wird es, wenn mehrere Personen erben und eine Erbengemeinschaft entsteht. Diese ist in der Regel nicht geeignet, ein Unternehmen zu führen. Unterschiedliche Interessen, fehlende unternehmerische Erfahrung oder Streitigkeiten können dazu führen, dass das Unternehmen zerschlagen wird oder insolvent geht.
Um solche Risiken zu vermeiden, sollten Sie als Einzelunternehmer*in frühzeitig ein Unternehmertestament erstellen. Darin können Sie festlegen:
wer das Unternehmen übernehmen soll
ob es verkauft oder in eine andere Rechtsform überführt werden soll
wie mit Schulden und Verträgen umgegangen wird
Ohne klare Regelung drohen nicht nur wirtschaftliche Verluste, sondern auch familiäre Konflikte. Die Erb*innen haften für alle Verbindlichkeiten, selbst wenn sie das Unternehmen nicht weiterführen möchten – es sei denn, sie schlagen das Erbe aus oder stellen die Geschäftstätigkeit innerhalb von drei Monaten ein (§ 27 Abs. 2 HGB).
Fazit
Die Haftung eines Einzelunternehmens ist umfassend und persönlich. Als Inhaber*in haften Sie in jeder Phase Ihres Unternehmens – von der Gründung über die Übernahme bis hin zur Auflösung oder Erbfolge – mit Ihrem gesamten Vermögen, also auch mit Ihrem Privatvermögen. Diese unbeschränkte Haftung macht das Einzelunternehmen zwar flexibel und unkompliziert in der Gründung, bringt aber erhebliche finanzielle Risiken mit sich.
Besonders kritisch wird es bei der Übernahme eines bestehenden Unternehmens, bei der Sie automatisch für Altverbindlichkeiten haften, sowie bei der Erbfolge, bei der die Erben ebenfalls in die volle Haftung eintreten. Auch bei der Auflösung endet die Haftung nicht sofort, sondern erst mit der vollständigen rechtlichen Abwicklung.
Um sich vor diesen Risiken zu schützen, sollten Sie frühzeitig über haftungsbeschränkte Rechtsformen, Versicherungen, rechtssichere Verträge und eine klare Nachfolgeregelung nachdenken. Eine professionelle Beratung ist dabei unerlässlich, um Ihr Privatvermögen wirksam abzusichern.